Das Gute bei Tolkien –
in Mittelerde und Der Herr der Ringe
© Frank Weinreich
Was antworten wir, wenn wir gefragt werden, was der Herr der Ringe eigentlich ist? … Fantasy! … Eine wahnsinnig spannende Geschichte! … Eine tolle Erzählung! Das könnten Antworten auf diese Frage sein.
Aber worum geht es denn eigentlich in dem Buch? Das wäre wohl die nächste Frage unseres Gegenübers. Nun, – so würden die meisten Antworten beginnen – es ist eine epische Geschichte vom Kampf des Guten gegen das Böse.
Ach ja … Gut gegen Böse … okay …
Und an dieser Stelle müsste man als Fan dann anfangen, zu erklären, was denn nun das Besondere ist. Gut gegen Böse, das war doch schon das Thema der ältesten Sagen der Menschheitsgeschichte und wird das Thema aller spannenden Geschichten bis irgendwann zum Holodeck der Enterprise sein.
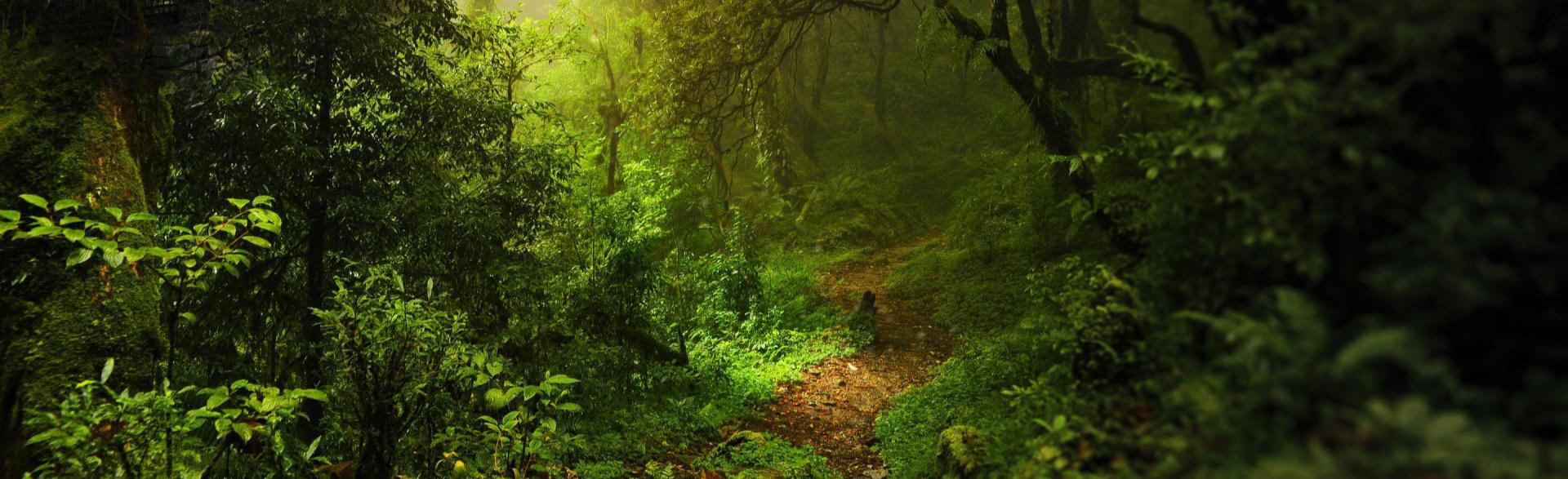
I
Gut und Böse sind besonders in der Fantasy immer das tragende Element der Geschichten gewesen. In diesem Zusammenhang wird jedoch andauernd ein bestimmter Standardvorwurf erhoben. Die Fantasyliteratur – so heißt es neben vielen anderen abwertenden Dingen immer wieder -, lebt von einem plumpen, einem naiven und einem primitiven oder sogar bewusst manipulativ eingesetzten Bild von Gut und Böse. In der Fantasy, so kann man dann beispielsweise lesen, sei alles rein schwarz oder rein weiß gezeichnet. Oder es wird behauptet, dass eine bestimmte Art von Fantasy Schwarz-Weiß-Stereotype in der Absicht einsetzt, bestimmte Personengruppen zu diskreditieren. Und auch Tolkien ist dieser Vorwurf gemacht worden – beispielsweise schon ganz früh in der rhetorisch gut gemachten Polemik „Oh those awful Orcs“ von Edmund Wilson aus dem Jahr 1956 – also ein Jahr nachdem HdR komplett erschienen war. Da stellt sich die Frage – wie sieht es denn nun mit dem Guten und dem Bösen in Mittelerde und im Herrn der Ringe aus?
Dass der Vorwurf der naiven Schwarz-Weiß-Malerei falsch ist, ist mittlerweile mehrfach in überzeugender Weise dargestellt worden. Beispielsweise auf der RingCon 2002 in einem hervorragenden Vortrag von Friedhelm Schneidewind. Auch Tolkien selbst fragt in einem Brief (L 154), wie dieser Vorwurf denn etwa auf Boromir oder Denethor anzuwenden wäre: beide handeln schließlich aus den besten Motiven heraus und doch kommt es fast zu fatalen Konsequenzen. Und auch Peter Jackson – den man als Regisseur natürlich auch als einen äußerst einflussreichen Interpreten Tolkiens ansehen muss – auch Jackson ist nicht in diese Falle getappt, wie die differenzierte Darstellung von Figuren wie Boromir aber auch Faramir und Gollum zeigt. Dieser Punkt soll deshalb auch gar nicht im Mittelpunkt stehen. Ich möchte ein wenig darüber nachdenken, wie es um das Gute in Tolkiens Welt bestellt ist.
Ich glaube, dass sich dabei zeigen wird, dass Tolkien eine klar bestimmbare Überzeugung vom Guten vertritt, die sich aus seiner Persönlichkeit und seinen persönlichen Überzeugungen erklären lässt und die sich prägend auf das Werk auswirkt. Tolkiens Begriff vom Guten zeigt sich im Werk – besonders im HdR aber auch in den zeitlich vorhergehenden Erzählungen aus der Geschichte Mittelerdes. Sie zeigt sich aber auch in seinen sonstigen Ansichten und Handlungen, soweit wir heute davon wissen. Mir geht es allerdings zuerst um sein Werk und darin besonders um den HdR.
Dabei wird sich nämlich eine interessante Besonderheit zeigen. Es ist nicht nur so, dass die Kritik falsch ist, die dem HdR eine naive Schwarz-Weiß-Malerei ankreidet. Die Untersuchung des Guten in den Büchern zeigt auch, dass die meisten der politischen oder politisch motivierten Vorwürfe gegen Tolkien schon deshalb unhaltbar sind, weil er Dinge als ‚gut‘; propagiert, die mit den gegen ihn in Stellung gebrachten Vorwürfen unvereinbar sind.
Tolkiens Werk hat von Anfang an eine Reihe von Vorwürfen auf sich gezogen. Grob kann man sie auf der einen Seite als literarische oder ästhetische Kritik bezeichnen – das ist Kritik wie sie beispielsweise ein Marcel Reich-Ranicki üben würde. Die ästhetische Kritik bezieht sich auf Vorwürfe wie den, der HdR sei amateurhaft geschrieben, die Geschichte sei infantil und die handelnden Figuren seien holzschnittartige Karikaturen echter Charaktere – Pseudocharaktere wie sie ein (wahrer?) Schriftsteller wie Thomas Mann oder Heinrich Böll nie entwickeln würde. Das alles sind Kritikpunkte wie sie beispielsweise Wilson in seinen „Awful Orcs“ anbringt. Über diese Vorwürfe kann man natürlich trefflich streiten, aber darum geht es hier nicht.
Auf der anderen Seite ist nun von politisch motivierter Kritik zu sprechen. Die Analyse des Guten bei Tolkien weist auf diese hin. Unter politischer Kritik sind Vorwürfe wie die folgenden zu verstehen: der HdR sei rassistisch, er transportiere ein faschistisches Weltbild und er befürworte den Verzicht auf Freiheit zugunsten feudaler Herrschaftsstrukturen. Ein wichtiger Punkt dieses Textes besteht darin, dass ich zeigen will, dass der Begriff des Guten, den Tolkien in den Mittelpunkt seines künstlerischen Werkes stellt, mit dieser politischen Art der Kritik unvereinbar ist.
II
Bevor es um den Begriff des Guten direkt geht, sind jedoch ein paar Bemerkungen zum Werk und zum Autor angebracht.
Tolkien wurde Ende des neunzehnten Jahrhunderts in Südafrika geboren. Als kleiner Junge schon kam er nach England zurück, woher die Familie ursprünglich stammte, und lebte dort bis an sein Lebensende im Alter von 81 Jahren. Ein jeder Mensch ist nun einmal ein Kind seiner Zeit und besonders prägend wirken Kindheit und Jugend.
Für Tolkien waren dies Jahre, in denen das britische Empire im Zenit seiner Macht stand und ungefähr ein Drittel der Erde und der auf ihr lebenden Menschen beherrschte. Die Familie stammte aus bürgerlichen Verhältnissen aber der frühe Tod der Eltern brachte Ronald – das war sein Rufname, nicht etwa John – in die Obhut der katholischen Kirche und in den heute vielleicht fragwürdig erscheinenden Genuss einer streng katholischen Erziehung. Die Mutter war vor ihrem Tod zum Katholizismus konvertiert. Ihre Söhne kamen dabei in Kontakt zu Pater Francis Morgan, einem katholischen Geistlichen, der später zu einer Art Ersatzvater für Ronald wird. Tolkien selbst sah dieses Schicksal immer als günstig an, hätte ihm doch nach dem Verlust der Eltern auch wirklich Schlimmeres zustoßen können. Dadurch wurde er jedoch auch zu einem tief gläubigen Christen, geprägt von der katholischen Lehre. Dies ist wichtig, weil es andere Auslegungen des Christentums gibt, auf die das nun Folgende nicht zuträfe.
Später studierte Tolkien, war Offizier im ersten Weltkrieg – wo er vieles über das Böse in der Moderne lernte (eine sehr gute Analyse des Einflusses dieses Krieges auf Tolkien findet sich jetzt in John Garths bemerkenswertem Werk Tolkien and the Great War; Garth 2003) – und wurde dann in den Zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts sehr schnell Hochschullehrer. Er gehörte in gesellschaftlicher Hinsicht also zur Upper Class. Diese Zeit nach dem ersten Weltkrieg waren für Großbritannien und die britische Seele nicht einfach, da sich nach dem ersten Weltkrieg das Ende des Empires in seiner bisherigen prachtvollen Form klar abzeichnete. Um so stärker hing man der alten Größe und den in ihr verkörperten Idealen nach.
Was bedeutet dieser biographische Exkurs für unser Thema? Er zeigt uns, dass Tolkien ein gläubiger Christ war und dass großbürgerliche Ideale tief in seine weltanschaulichen Überzeugungen integriert waren. Beides wirkte sich prägend auf sein künstlerisches Schaffen aus.

Sein Christsein schlägt sich in dem Glauben an die unbedingte Existenz des Guten auch in der erfundenen Welt nieder. Das Gute besteht in unserer Welt ebenso wie in Mittelerde schon deshalb, weil es eine Schöpfung gab. Das Gute ist zudem die bestimmendere der beiden Mächte im Kampf mit dem Bösen. Tolkien schrieb schon Ende der Dreißiger Jahre, also 15 Jahre bevor der HdR erschien, dass jede Fantasygeschichte – er benutzte den Ausdruck fairy story – eine Wiederholung der Schöpfungsgeschichte sei. Dies gilt auch für Mittelerde und das heißt dann auch, dass die Schöpfung primär gut ist, auch wenn das Böse in ihr entstehen kann. Und es heißt auch, dass die Erlösung möglich ist und gewährt wird. Schon auf dieser basalen Ebene von Tolkiens Werk ist es also sehr schwer, sich etwas durch und durch Böses überhaupt vorstellen zu können.
Friedhelm Schneidewind hat vor einem Jahr hier gezeigt, dass selbst das personifizierte Böse, dargestellt in den Personen Melkors aus dem Silmarillion und Saurons aus dem HdR, nicht von Anfang an Böse war, sondern durch typisch menschliche Eigenschaften erst böse wurde. Freiheitsdrang und Geltungsbewusstsein schlagen um in Gier und rücksichtsloses Machtstreben – nicht anders als bei vielen Revolutionären auf unserer Erde, deren politische Karriere sie den ganzen Weg bis zur Tyrannei beschreiten ließ. Melkor etwa ist in den Worten Schneidewinds zunächst ein „eigenständiger schöpferischer Geist“ und erinnert verblüffend an den Luzifer aus der Dichtung John Miltons (Paradise Lost). Sauron war ursprünglich ein Maia – also eine Art guter Engel im Pantheon Mittelerdes und hatte damit anfangs die gleiche Rolle wie Gandalf. Sauron und Melkor aber wollten mehr als die ihnen zugedachte Rolle und sie überschritten die Schwelle zum Bösesein durch die Wahl ihrer Mittel und Ziele.
Böse wird man in Tolkiens Mittelerde durch eigene Handlungen. Das entscheidende Konzept im Spannungsfeld von Gut und Böse ist das des freien Willens, der die Akteure aus eigener Verantwortung in Glück oder Unglück treibt. Das entspricht der christlichen Überzeugung, dass die Handlungen des Menschen sein Schicksal bestimmen. Tolkien schrieb einmal, dass der Mensch nicht einfach nur ein Same sei, der gemäß seiner Anlagen und der Umwelteinflüsse gut oder schlecht wachse, sondern dass er auch Gärtner sei und das Gedeihen seiner selbst wie seiner Umwelt durch bewusste Entscheidungen zum Guten oder Bösen lenke1 (L 183). Wir können also festhalten, dass das Gute wesentlich durch christliches Gedankengut beeinflusst ist und dass es das Resultat von verantwortbaren Handlungen ist.
Des Weiteren ist die Biographie Tolkiens wichtig, wenn man sich fragt, warum das Gute inhaltlich und personell gerade so skizziert wird, wie es in den Büchern nun nachzulesen ist. Warum sind die Helden Zauberer, Könige oder Prinzen? Warum sind Frauen fast nur Staffage? Warum ist das langweilige Auenland ein Idyll? Erstens liegt das daran, dass dies eben die Ideale eines Menschen mit dem biographischen Hintergrund Tolkiens waren und zweitens stimmt diese Beobachtung ja nicht einmal: Tolkien ist in erstaunlicher Weise über die Schatten der idealistischen Vorstellungen seiner Zeit und des literarischen Genres gesprungen.
Was meine ich damit?
Erstens war das Ideal des untergehenden Empires die viktorianische Zeit und das war eine Zeit, in der die gesellschaftliche Ordnung und der Frieden durch tief verwurzelte Hierarchien und durch Ständedenken garantiert waren. Da es zudem eine Zeit wirtschaftlichen wie intellektuellen Fortschritts war, die sich durchaus positiv von den davor liegenden Jahrhunderten abhob – zumindest für das Bürgertum -, war es nur natürlich, das viktorianische Zeitalter und die Gründe, aus denen es funktionierte, zu idealisieren und zur Grundlage gesellschaftlicher Ideale der erfundenen Welt Mittelerde zu machen: Also ist Mittelerde hierarchisch organisiert und eben keine Basisdemokratie schweizerischer Art. Also hat Mittelerde starke und primär auf Grund ihrer Herkunft legitimierte Führer wie Aragorn und Elrond und wird eben nicht von demokratisch gewählten Abgeordneten regiert.
Und das ist ja für ein Märchen wie den HdR auch völlig in Ordnung, weil Leute wie Elrond und Aragorn bis auf die Knochen gut und weise sind. Es wäre ja sogar für die echte Welt in Ordnung, solche Staatsmänner an der Spitze zu haben – nur gibt es solche Leute eben in Wirklichkeit nicht, weshalb derartige Systeme in der Realität immer in Tyrannei und Ungerechtigkeit enden.
Eben wegen der Verwurzelung in den Überzeugungen seiner Zeit spielen auch Frauen kaum eine Rolle im HdR. Das war für einen Mann wie Tolkien halt so: die Frau blieb in Europa bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts zu Hause und machte keine Politik und führte auch keine Kriege.
Zweitens stimmt das eben Gesagte aber nur bedingt und das zeigt, wie weit Tolkien über die Schatten seiner Zeit zu springen vermochte. Es sieht ja nur auf den ersten Blick so aus, als bestimmten die Mächtigen und die Männer das Geschehen. Der Ring wird den Kleinsten und Schwächsten anvertraut und niemand von den Großen wäre auch nur halb so weit gekommen wie Frodo und Sam. Gandalf und seine Heere in Helms Klamm wie auch vor Minas Tirith sind zweimal auf die Hilfe der vermeintlich Schwachen angewiesen. Zuerst überreden zwei Hobbits die Ents gegen alle Wahrscheinlichkeiten zum rettenden Eingriff und später töten ein Hobbit und eine Frau den feindlichen Heerführer, der Gandalf schon fast vernichtet hatte.
Besonders dieser zweite Punkt und die Beispiele von Frodo, Sam, Merry. Pippin und Eowyn führen nun zu dem besonderen Charakter des Guten bei Tolkien, der sich auch hierin als stilbildend für das Genre erwiesen hat.
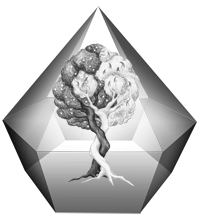
III
Es war festgehalten worden, dass die moralische Qualität der Lebensführung der von Tolkien erfundenen Charaktere von der Art und Weise abhängt, wie sie ihren freien Willen ausüben. Das ist im Vergleich zu klassischen Sagen etwas Neues und Modernes: „Tolkien emphasizes the idea that all intelligent beings are born with a free will. The ability to keep and use this will is the most important theme present in this epic novel“ (Bullock 1985, 29).
In der klassischen Sage sind es meist übernatürliche Mächte, die das Schicksal der Menschen lenken und dafür sorgen, dass sie trotz all der Anstrengungen völlig in der Hand der Götter oder des Schicksals sind: das ist das Motiv der klassischen Tragödie. Ob Ödipus oder Siegfried – niemand vermag nach dieser fatalistischen Sichtweise seinem Schicksal zu entgehen.
Tolkien wendet mit seinen Beispielen für das Gute die Stereotypen der klassischen Sage auf positive Weise in die Moderne. Wenn man die Fantasy bei den Sagen der Antike beginnen lässt, was meiner Meinung nach erforderlich ist, da die Fantasy unserer Tage spielerisch an die alte Sagenwelt anschließt, so begegnet man seit den Anfängen menschlicher Fabulierkunst eher Archetypen in den Erzählungen als echten Charakteren. Man könnte etwas gemeiner auch von Klischees und Götzenbildern reden. Sicher, Achilles hat seine Sehne und Siegfried fiel dieses dumme Blatt auf den durchtrainierten Rücken, aber ansonst sind diese Superhelden in allen Belangen sehr viel ‚bigger than life‘ und ihre Taten erst recht. In der Tolkien zeitgenössischen Fantasy ist das nicht viel anders – man denke nur an Conan oder Flash Gordon. Wohin man in der Fantasy bis in die Fünfziger Jahre schaut, überall Gestalten als wären sie von Nietzsche erfunden worden.
Das ist auch verständlich und es war früher sinnvoll, da die Sagen der Altvorderen dazu dienten, die Welt zu erklären, indem den Göttern und ihren Auserwählten die gleichen Schwächen unterstellt wurden, die auch wir Menschen haben. Dies erklärte die Ungerechtigkeiten der menschlichen Existenz und versöhnte vermittels der Impfung mit einer gehörigen Dosis Fatalismus mit den Wechselfällen des Lebens: wenn selbst Göttersöhne leiden mussten, dann hatten die Menschen keinen Grund, sich zu beschweren.
In einer entmystifizierten Ära wie der Neuzeit und noch stärker in der folgenden Moderne, in der Tolkien seine Werke verfasste, konnte man so aber nicht mehr erzählen, zumindest nicht, wenn man seine Erzählungen so ernst nahm, wie Tolkien dies mit seiner Schöpfung tat. Und man kann so nicht mehr erzählen, wenn man ein gläubiger Christ vom Maße wie Tolkien ist.
Also durchbricht unser Autor dieses Schema, ja er stellt es geradezu auf den Kopf. Dies wird erreicht, indem vergleichsweise kleine und unbedeutende Charaktere in den Vordergrund gestellt werden und die Geschicke der Welt entscheidend beeinflussen: Da wird das Schicksal Mittelerdes, der eine Ring, in die Hände eines bäuerlichen Charakters mit der Statur eines Kindes gelegt – und das Kind erfüllt eine Aufgabe, an der übermenschliche Charaktere wie Gilgalad, Elendil und Isildur scheiterten. Tolkien bestätigt meine Interpretation in einem Brief an seinen Verleger Milton Waldman folgendermaßen:2 „Hier begegnet uns unter anderem das erste Beispiel für das (mit den Hobbits dann beherrschend werdende) Motiv, das bei den großen Entscheidungen der Weltgeschichte, ‚im Räderwerk der Welt‘, oft nicht die Großen und Mächtigen, nicht einmal die Götter den Ausschlag geben, sondern die scheinbar Schwachen und Unberühmten“ (Tolkien, in Pesch 1984, 34).
Diese Vorgehensweise stellt eine sehr konstruktive Art und Weise dar, mit dem Mythos umzugehen. Das ragt aus der zeitgenössischen Fantasy Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts äußerst positiv heraus und zeichnet ein innovatives Bild des Guten in der phantastischen Literatur.
Tolkiens von christlichem Gedankengut durchtränkte Kosmogonie einer von einem liebenden Schöpfergott erschaffenen Welt, in der jeder seines Glückes Schmied ist und in der, wer sich nur bemüht, am Ende auch errettet wird, diese Welt ist trotz Saurons und trotz Mordors letztlich doch eine sehr schöne und erstrebenswerte Welt.
Andere Fantasyautoren dieser Zeit schreiben mit sehr viel mehr Pessimismus. Etwa Robert E. Howard, der Schöpfer von Conan, dem Barbaren. Wieder andere Autoren schreiben mit deutlich weniger Überlegung und liefern Billigware ab wie Lin Carter, der nach Howards Tod Geschichten über Conan schrieb, oder John Norman und sein unsäglicher Zyklus von Gor, der Gegenerde. Howards Schöpfung Conan ist demgegenüber ein weithin unterschätztes Zeugnis der Zivilisationskritik der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, wie sie immer wieder gerade in der phantastischen Literatur zum Ausdruck kommt.
Die Figur Conans ist erfüllt von tiefem Misstrauen gegenüber jeglicher Zivilisation. Und das ist auch gerechtfertigt, erfährt er in zivilisierter Umgebung in jedem seiner Abenteuer doch nichts anderes als Verrat und Heimtücke. Dunkel sind auch die Götter bei Howard. Conans Stammesgott Crom etwa ist ein finsterer und rücksichtsloser Herr über den Tod: „Er war auf einem hohen Berg zuhause, von wo aus er Tod und Verderben schickte. Es war nutzlos, Crom um etwas anzuflehen, denn er war ein düsterer, wilder Gott und verachtete Feiglinge“ (Howard 2003, 132).
Was für ein Gegensatz zu Iluvatar, dem Gott Mittelerdes, der seine Schöpfung als eine Symphonie des Seins musikalisch ins Werk setzt und an deren Ende die Erlösung für alle, selbst für Melkor und Sauron, in Aussicht stellt. Auch Tolkien war ein starker Kritiker der modernen Welt. So bezeichnete er beispielsweise einmal die Verstädterung und Industrialisierung unserer Erde als „Mordor in unserer Mitte“ (L, p. 165). Seine Reaktion ist jedoch nicht Resignation, sondern ein Gegenentwurf, der dem Bösen Mordors Ehrlichkeit, Loyalität, Tapferkeit und Glauben entgegensetzt.
Das einzige was man bei Conan als Gutes ausmachen kann, ist die Kampfkunst und an deren Ende steht immer wieder nur der Tod. Das Gute bei Tolkien, das in den Handlungen der Gefährten, besonders in denen der Hobbits, zum Ausdruck kommt, ist dagegen lebensbejahend.
Vor allen Dingen aber ist das Gute bei Tolkien eine menschliche Qualität, die jedem zur Verfügung steht, der bereit ist, sich zu bemühen und es handelt sich nicht um eine Superheldeneigenschaft. Wer dieses Bemühen zeigt, so wie Frodo dies tut, und dann trotzdem unterliegt, wie es ohne göttliche Hilfe gegen so eine böse Macht wie den Ring unweigerlich kommen muss, der wird dann auch errettet werden und sei es durch eine eigentlich böse Absicht, wie Gollums letzte Tat.
Noch ein zweites neues Element finden wir bei der Betrachtung des Guten im Herrn der Ringe, welches wiederum in enger Verbindung zum ersten steht: den Gemeinschaftsgeist. Salopp gesagt erfindet Tolkien die Abenteurerparty, das Kernstück allen Rollenspiels.
Das ist neu, weil in den Sagen und der phantastischen Literatur vor Tolkien der Einzelkämpfer vorherrscht. Das wird nicht immer so deutlich wie bei Herakles, der seine Aufgaben ja ausdrücklich alleine zu erledigen hat, aber auch die Helden, die Troja angreifen, handeln nicht als Gemeinschaft, sondern als eifersüchtiger Haufen geltungsbemühter Narzisse. In der Fantasy sind es ebenfalls Geschichten von individuellen Großtaten, die das vorherrschende Thema bilden. Als Beispiel mag auch hier wieder Howards Conan dienen. Dies gilt bei Tolkien nun alles nicht mehr: „In Middle-Earth, however, heroic acts are carried out in a social context“ (Crowe 1983, 7).
Im Ring-Zyklus wird eine Gruppe auf die Beine gestellt, die ihre Aufgabe nur erledigen kann, wenn sie gemeinsam und uneigennützig handelt. Das gilt sogar gerade da, wo die Gruppe zerrissen wird und Merry und Pippin, Aragorn, Gimli und Legolas und Sam und Frodo jeweils alleine losziehen müssen. Auch hier greift noch alles ineinander: Der dunkle Herrscher bemerkt Frodo und Meister Samweis nur deshalb nicht, weil er von den Kämpfen um Minas Tirith abgelenkt wird, Minas Tirith kann sich am entscheidenden Tag nur halten, weil die Reiter von Rohan gerade noch rechtzeitig auftauchen und Aragorn die Verstärkung durch die Corsaren von Umbar verhindert. Die Rohirrim und Aragorn wiederum hätten nie eingreifen können, wenn Merry und Pippin nicht die Ents gegen Saruman ins Felde geführt hätten. Letztlich greift auch das Grundmotiv des Herrn der Ringe die Gemeinschaftsidee auf: Sauron wird nur besiegt, weil er sich einfach nicht vorstellen kann, dass ein Kollektiv zusammenarbeitet, aus dem sich keiner als Ringträger zum Führer aufschwingt.
IV
Der Gemeinschaftsgedanke bezieht sich übrigens auch auf die Zusammengehörigkeit aller denkenden Wesen. Dem HdR werden von Kritikern ja gerne rassistische Motive unterstellt, weil die Guten alles hochgewachsene Weiße aus dem Westen seien, während die Bösen kleine, kriecherische Orks mit schwarzer Hautfarbe sind oder sich aus irgendwelchen Völkern aus dem fernen Osten oder Süden rekrutieren. Das lässt sich aber so nicht halten, denn die Welt Mittelerde gehört allen. Keinem Volk wird sein Platz bestritten.
Wenn der Autor denn so auf reines Blut stünde, wie die Kritik vermutet – wieso wird dann eine rassisch heterogene Gruppe aus Maia, Elb, Zwerg, Menschen und Hobbits in den Mittelpunkt gestellt, deren einziger moralischer Schwächling übrigens der arischste Charakter ist? Außerdem zeigt die eben aufgeführte Kette der ineinander greifenden und voneinander abhängenden Ereignisse, dass das Gute sich nur durchsetzen kann, wenn alle Gutwilligen zusammenarbeiten – was sich bis auf unzivilisierte Wilde erstreckt, die ebenfalls das in ihrer Macht stehende tun, um das Böse zu stoppen.
DasGute bei Tolkien zeigt sich also in den guten Taten und in der Gutwilligkeit, einander als freie Wesen respektieren zu wollen und zur Not ungeachtet von Stand und Rasse miteinander das Nötige zu tun, um das Böse aufzuhalten.
Das Böse wiederum kann in seiner knappsten Form als die genaue Umkehrung des Guten beschrieben werden. „Das Böse ist mehr als das Gute, dass man lässt, denn […] zum Bösen gehört, daß ausdrücklich und mit Nachdruck das Widergute an die Stelle des Guten gesetzt wird“ (Pieper 1997, 16). Bei Tolkien bedeutet das dann: Böse ist, wer Böse handelt. In dieser banalen Formulierung liegt ein tieferer Sinn, denn worauf es Tolkien ankommt, das ist die verantwortbare Handlung, die Gut und Böse ausmacht.
Zu Handeln heißt im klassischen ethischen Sinne dieses Begriffs eine bewusste Entscheidung zu einer bestimmten Tätigkeit oder ihrer Unterlassung zu treffen. Tolkien selbst hat das mal am Beispiel Sarumans ausgeführt (L 210, p. 276f.): Sarumans Stimme funktionierte nicht durch Magie, sondern durch ganz normale List und Tatsachenverdrehung: Zuhörer „were not in danger to fall in trance, but of agreeing with his arguments while fully awake. It was always open to one to reject“ – es stand allen also frei, die Argumente zurückzuweisen.
Und es steht allen Wesen in Mittelerde frei, Versuchungen zurückzuweisen. Niemand ist böse geboren – selbst Melkor nicht, auch Sauron nicht. Und da wo jemand ‚gemacht‘ ist, wie die Orks3, von denen es heißt, dass sie von Melkor als böse Wesen geschaffen wurden, da kann von freiem Willen nicht mehr die Rede sein. Dann aber ist es den Orks auch nicht vorzuwerfen, dass sie böse handeln, sie können ja gar nicht anders und sind zu bedauern, nicht zu verurteilen.
Wenn aber Gut und Böse die Ergebnisse von Entscheidungsprozessen und verantwortlichen Handlungen sind, dann treffen auch eine Reihe von anderen, politisch motivierten Vorwürfen gegen den HdR nicht zu.
Chauvinismus und Paternalismus – also die Unterdrückung auf Grund des Geschlechts oder einfach der Versuch, Andere unmündig zu halten, sind schlecht, weil die Verantwortlichkeit der Betroffenen für ihre Lebensführung unterdrückt wird. Da diese Freiheit aber für Tolkien die Voraussetzung für die gute Lebensführung ist, wie kann man ihm dann die Unterstützung paternalistischer oder chauvinistischer Weltanschauungen unterstellen?
Der Vorwurf, im HdR den Faschismus zu unterstützen, ist vor diesen Überlegungen sogar absurd. Der Clou des faschistischen Denkens besteht darin, Menschen in blinden Gehorsam auf einen Führer und seine Ideologie einzuschwören. Freiheit und Handlungsfreiheit stehen dem diametral und absolut unvereinbar gegenüber.
Das Thema Rassismus wurde schon erwähnt als auffiel, dass alle Völker zusammengerufen werden und nur gemeinsam gegen den Feind bestehen können. Das könnte man noch als oberflächlich abtun oder sogar sagen, dass die Elben eben für Adlige stehen, die Hobbits für die Landbevölkerung, die Zwerge für die Handwerker – das aber eben immer noch ein Volk beziehungsweise eine Rasse – eben die weiße, westliche unserer Welt – gemeint sei. Okay – das wäre zunächst möglich. Aber es ist nicht mehr möglich vor dem eben skizzierten Hintergrund. Böse oder schlecht ist man in Mittelerde nicht durch Geburt oder Blut! Zum Bösesein muss jeder schon seinen eigenen, bewussten Beitrag leisten („s.o. Zitat Pieper: „ausdrücklich und mit Nachdruck“). Rassisten aber reisen auf dem Ticket, dass es gerade die Abstammung ist, die über gut und böse, über wertvolles und unwertes Leben entscheidet.
Ein weiterer Globalvorwurf, der die drei vorher genannten Punkte in sich einschließt ist der, das Tolkien mit seiner mittelalterlichen, ständisch und feudal organisierten Welt und seiner in vielen Kommentaren bezeugten Modernitätskritik ein reaktionäres Werk verfasst habe. Nun, zunächst müsste man sich auf eine Definition von reaktionär einigen – was aber für den vorliegenden Zusammenhang gar nicht notwendig ist, weil folgender Hinweis reichen sollte. Die im HdR aber idealisierten Haltungen, als da sind Offenheit, Besonnenheit, Rücksichtnahme und Verantwortungsbewusstsein: das sind Ideale der Aufklärung.4 Die Aufklärung aber, die sich auf den von Kant stammenden Satz reduzieren lässt, dass sie „der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit“ sei (KWA XI, 53), kann gar nicht reaktionär sein, da sie nie reagiert, sondern das Agieren fordert.
Natürlich war Tolkien ein Konservativer, mit dem wir sicherlich über viele uns selbstverständlich erscheinende Punkte in heftigen Streit geraten könnten, aber ein Reaktionär, ein Rassist, ein Faschist, ein Chauvinist – das alles kann er nach dem, was man im Silmarillion, im Hobbit und im Herrn der Ringe liest, nicht gewesen sein.
1 „A man is not only a seed, developing in a defined pattern, well or ill according to its situation or its defects as an example of its species; a man is both a seed and in some degree also a gardener for good or ill“ (Tolkien: Letters; Letter 183, p. 240).
2 Das Original ist abgedruckt in: Letters of J.R.R. Tolkien, 143 – 161, Übersetzt und separat abgedruckt in Pesch (Hrsg.): Tolkien – der Mythenschöpfer. 1984
3 Orks haben im Gegensatz zu Zwergen, die ja auch von Aule ursprünglich ‚gemacht‘ worden sind, auch wenn sie sich jetzt normal fortpflanzen, keinen freien Willen. Zwerge sind für ihre Handlungen verantwortlich, Orks nicht.
4 Oliver Bidlo weist in Sehnsucht nach Mittelerde? darauf hin, dass Tolkien Romantiker sei. Das stellt er sehr überzeugend dar, aber dieser Befund schließt m.E. nicht aus, dass auch Ideale der Aufklärung vertreten werden, selbst wenn die Aufklärung und die Romantik in vielem unvereinbar sind, und die Romantik eine Gegenbewegung zur Aufklärung war.
Bochum, 11/03












