All appearances to the contrary,
the only watchmaker in nature
is the blind forces of physics.
(Richard Dawkins: The Blind Watchmaker)
Gottes Dasein
© Frank Weinreich 03/01

Eine Frage, die Menschen aller Zeiten immer beschäftigte und beschäftigt, ist die Frage nach einem höheren Wesen und den ganzen Implikationen, für die ein – oder mehrere – höhere Wesen stehen: Die Existenz einer unsterblichen Seele, Strafe und Belohnung in einem metapyhsischen Sinn und der Sinn der eigenen Existenz.
Es ist bezeichnend für den Menschen, daß die Implikationen immer viel wichtiger sind als das Wesen selbst.
In der Frühzeit des Christentums bedurfte der Glaube noch keines Daseinsbeweises Gottes, da ein wie auch immer geartetes höheres Dasein vorausgesetzt wurde und der Atheismus kein Begriff war. Es ging um den Erweis Gottes, nicht um einen Beweis!
Die ursprüngliche Motivation für die Gottesbeweise war denn auch die, sich von den Theoretikern eines seinslosen Gottes absetzen zu wollen, da ein solcherart verstandener Gott nur ein unbestimmter Abgrund war. Den frühen Gottesbeweisen ging es also in erster Linie um eine Bestimmung, eine Präzisierung Gottes und damit auch noch hauptsächlich um einen Erweis.
Das Bild des seienden und in seiner Form bleibenden Gottes wurde von den Theologen aus dem antiken Ideal der Höherwertigkeit des Bleibenden gegenüber über dem Veränderbaren geschöpft. Letztendlich fußen die Gottesbweise aus Materialien aus Platons, Aristoteles, Ciceros und Plotins Schriften. Durch die Gottesbeweise, die einen Geniestreich darstellen, auch wenn sie letztendlich nicht haltbar sind, wird die Welt und das Sein überhaupt als der Vernunft unterworfen bestimmt. Die Gottesbeweise setzen die Rationalität der Welt voraus und stellen in dieser Hinsicht eine neue Qualität dar, die über den bloß fideistischen Charakter der zugrundeliegenden Religionen hinausweist. Allerdings folgten sie damit auch einer allgemeinen historisch nachweisbaren Rationalisierungswelle, die in der Antike beginnt und im Mittelalter – entgegen der Meinung, daß es finster gewesen sei – nicht untergeht, sondern in den Personen und Werken Anselms v. Canterbury, Thomas v. Aquin und anderen den Durchbruch in der Renaissance und Neuzeit vorbereitet. Dieser Strömung mußte das Christentum folgen, wenn es nicht als Sektierertum enden wollte. Den höchsten Ausdruck dieses wunsches auch den Glauben der Vernunft zugänglich zu machen findet sich in Anselms Satz vom „Glauben, der Verstehen sucht“.
Ein Teil der Beweise geht von der Unmöglichkeit eines regressus ad infinitum der Ursachen aus. Sie machen damit die Erfahrung überschaubar und bringen den unbestimmten Gott und die bekannte Welt zusammen. Vernunftstruktur wird hier als Realstruktur postuliert. Doch diese Vernunft, die doch nicht mehr als eine menschliche ist, schrieb sich in den Himmel, wo sie nicht hingehört.
Man kann 4 Typen von Gottesbeweisen unterscheiden
1. Die eidetische Reduktion.
Sie schließt von der Unvollkommenheit der Realität auf ein ideales Vorbild, daß aus dem Grunde notwendig ist, da die minderen Formen der erfahrbaren Umwelt ohne sie nicht existieren könnten. Dieser Typus ist aus platonisierenden Einzelstücken zusammengestellt (bspw. Augustinus, De Trinitate 8,3) und beruft sich im wesentlichen auf die von Platon entworfene Ideenwelt. Dieser Beweis hat den Mangel, daß er sein Ergebnis voraussetzt.
2. Das kosmologische Argument.
Die Grundlage stammt von Platon (aus dem Phaidros), ausgearbeitet wurde es von Aristoteles. Da es in der empirischen Realität Veränderungen gibt, müssen diese auch Ursachen haben. Um den regressus zu vermeiden, ist ein Anfang notwendig. Daß es Veränderung gibt wird vorausgesetzt. Die zweite Voraussetzung ist die, daß es eine außerhalb der Dinge liegende Ursache geben muß. Das aber ist nicht sicher. Hume bspw. betrachtete diese Erfahrung als Glauben, die Allgemeinheit dieser Sätze ist unsicher. Die Verursachung aller Ursachen wird als wißbar vorausgesetzt. Dieser Satz ist rational einlösbar. Das setzt dann voraus, daß das Kausalgesetz über die erfahrbare Welt hinausgeht. Dann kommt man aber in das Dilemma weiterfragen zu müssen „Was ist dann die Ursache Gottes?“; es soll doch alles eine Ursache haben … Auch hier wird dann wieder die Unmöglichkeit des regressus vorausgesetzt. Der horror infiniti ist der Natur allerdings erst vom Menschen zugeschrieben worden. Wie überhaupt kann dann aber auch ein Unveränderbares, Ewiges Veränderungen bewirken? Die Philosophie ist Untersuchung, nicht Lieferung von Begründungen.

3. Teleologische Typen.
Die Welt hat ein Maß an Ordnung, das nicht zufällig sein kann. Das ist anschaulich und zeigt Gott als planenden Geist, der die Weltteile aufeinander zudenkt und kommt so dem Anthropomorphismus der religiösen Sprache entgegen. Das ist im Prinzip die Umkehr des genetischen Denkens: ‚Weil die Umstände so waren konnte/musste es dazu kommen‘. Die Zeit ist über die Teleologie hinweggegangen. Zwar kommt es immer wieder zu telelogischen Beweisversuchen aus der Ecke der Kreationisten. Die moderne Physik, Chemie und Biologie lassen keinen Zweifel daran, dass die Ordnung des Kosmos und das Funktionieren von Leben ohne göttlichen Plan – und auch ohne den Anstoß des kosmologischen Arguments – auskommen. Christian de Duve bspw. hat in seinem Buch: „Aus Staub geboren. Leben als kosmische Zwangsläufigkeit“, alle Erkenntnisse der Naturwissenschaften hinsichtlich Kosmos und Evolution in einem überzeugenden Argumantationsstrang niedergelegt.
4. Der ontologische Typus.
Der eleganteste und philosophischste Beweis. Er ist der wesentliche Inhalt der philosophischen auseinandersetzung mit Gottesbeweisen seit Anselm von Canterbury, der ihn im späten 11. Jahrhundert in seiner stärksten Form entwickelte. Das Argument zeichnet sich durch einen vollkommenen Absolutheitsanspruch aus. Das Problem liegt in dem Vergleich von realem und gedachtem Wesen. Kann man einen solchen Vergleich auf einer einheitlichen Gradskala auftragen? Wieder schimmert der klassische Vernunftbegriff durch: Sein heißt besser sein. Hier erreicht das Bestreben der Einheitssetzung dieses Vernunftbegriffs seinen Höhepunkt. Gott ist hier die immanente Voraussetzung eines mächtigen Konzepts von Vernunft.
Anselm definiert Gott als dasjenige Wesen, „über das hinaus nichts Gößeres gedacht werden kann“(„quo nihil maisu cogitare possit“; Kann Gottes Nicht-Sein gedacht werden?, 50f). Wäre das Wesen, „über das hinaus …“ wirklich dasjenige, über das hinaus etwas Größeres nicht gedacht werden kann, wenn es nicht auch existierte? Muss ein derart hohes/großes Wesen nicht notwendig existieren? Für Anselm steht dies fest.. Anselm hat mit seiner Definition dessen, „über das hinaus …“ ein Wesen beschrieben, welches Existenz als absolute Notwendigkeit mit einschließt. So fällt es schwer, dieses eine Subjekt (und nur dieses) einfach mit all seinen Prädikaten aufzuheben. Der Vergleich mit einem normalen Gegenstand der Erfahrung, etwa einer Triangel, trifft da nicht zu. Von einer Triangel kann man sagen: Ich nehme ihre drei Seiten weg und schon ist es keine Triangel mehr. Führe ich die gleiche Operation beim Wesen „über das hinaus …“ durch und nehme dieses Attribut einfach weg – so erkenne ich, dass diese Operation nicht legitim ist, da das Absolutheitsprädikat sich der Auslöschung durch seine absolute Eigenschaft widersetzt.
Denn das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, ist ein Grenzfall, dem man sich, mangels Erfahrbarkeit, allein mit dem Verstand nähern kann. Der Verstand konstruiert ein Wesen, dem Existenz unabdingbar implementiert ist. Ein solches Wesen zu entwerfen, aber nur eines, liegt durchaus in den Möglichkeiten rationaler Überlegung. Aber es kann sich innerhalb der Vernunft immer nur um einen Entwurf handeln! Die Realität mag diesem Entwurf durchaus entsprechen, es mag mithin ein Wesen „über das hinaus…“ geben, aber es läßt sich nicht beweisen. Das Wesen anhand des Argumentes: „Es existiert, weil Existenz seine Voraussetzung ist, alles andere ist nicht das Wesen, das ich meine.“ beweisen zu wollen ist unzulässig, da der Gegenstand, den ich beweisen will, als Beweisgrund herhalten muß. Normalerweise würde man dieses Urteil jetzt mit Beispielen zu belegen suchen, das halte ich für unmöglich. Insofern nämlich Anselms Gott ein absolutes Unikat ist, so ist es auch unvergleichbar, und Beispielgebung läuft immer auf einen Vergleich hinaus.
Trotzdem bleibt der Verstoß gegen die Regeln der Beweisführung. Zerlegt man den Beweis in seine Bestandteile, so ergeben sich folgende Sätze:
Gott ist das Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann
+
Das größte Denkbare hat Existenz
=
Gott existiert
Wir haben es hier mit einer logischen Implikation zu tun, deren Ergebnis eindeutig zu ergeben scheint, daß Anselms Argument stichhaltig ist, denn, wenn die Prämissen wahr sind, so muß die Konklusion ebenfalls wahr sein, andernfalls ergibt sich ein Widerspruch. Der Fehler liegt auch nicht im Aufbau des Arguments, er liegt in seinem Inhalt. Die Definition Gottes als eines Wesens, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, impliziert alleine schon Existenz. Das heißt, daß die Prämisse in der Folgerung angelegt ist und sich somit selbst beweist. Kant hat mit dem Vorwurf der Tautologie recht (Kritik d.r. Vernunft B620/A592 – B630/A603), es ist ein Zirkelschluss. Der den Regeln des Schlusses folgende äußere Aufbau des Arguments kann nicht notwendigerweise inhaltliche Richtigkeit für sich beanspruchen , da sie für die Vorgehensweise nicht notwendig ist. So kann die Folgerichtigkeit des Argumentes wohl den Anschein der Unumstößlichkeit des Beweises erwecken, genau betrachtet wird aber das zu beweisende Moment der Existenz dem Beweis schon vorangestellt. Damit kann Gott natürlich immer noch all das sein, als was Anselm es begreift, aber als Beweismittel ist das „über das hinaus…“ doch nur ein Lautgebilde.
Meines Erachtens nach war Anselm sehr nah daran, Gottes Existenz wirklich zu beweisen. Wahrscheinlich kam er so nah, wie man dem Gottesbeweis überhaupt kommen kann. Doch Gottes Existenz läßt sich nicht beweisen! Gott läßt sich dem Bereich des Glaubens nicht entreißen. Eines Glaubens, den Gott – so es ihn gibt – von den Menschen höchstens als Vorleistung erwarten kann, nicht als Folge eines Existenzbeweises.
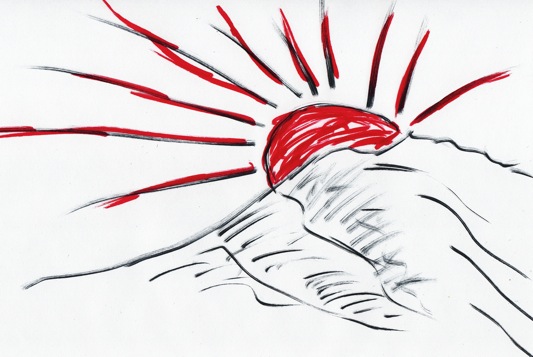
Ich beziehe mich in meinen Überlegungen auf Gedanken, die Kurt Flasch in der Vorlesung „Warum ich kein Christ bin“ formulierte, auf intensive Gespräche mit Rudolf Rehn und auf folgende Literatur:
Mojsisch, Burkhard (Hrsg.): Kann Gottes Nicht-Sein gedacht werden? Die Kontroverse zwischen Anselm von Canterbury und Gaunilo von Marmoutiers. Lat.-dt. Ausgabe. Excerpta Classica Band IV. Kempten 1989.












